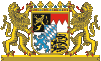Rotwild
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© moonflash-Fotolia.com
Menschliche Nutzung beschränkt den Lebensraum
Der Rothirsch, so die zoologisch korrekte deutsche Bezeichnung für das männliche Rotwild, wird umgangssprachlich oft einfach als "Hirsch" bezeichnet. Als größte Wildart, die unsere Kulturlandschaft dauerhaft bewohnt, bietet er einen imposanten Anblick. Rund 30.000 Hirsche, Hirschkühe und Kälber, wie die Familienmitglieder heißen, leben bei uns in Bayern.
Expertenwissen Rotwild

In Zeiten des Klimawandels erlauben aktuelle wildbiologische Studien Einblicke das Raum - Zeitverhalten des Rotwildes. Wie lässt sich der Zustand einer Rotwildpopulation abschätzen? Wie verändert sich das Raumnutzungsverhalten im Jahresverlauf? Und wie passt sich das Rotwild an den Winter an? Im "Expertenwissen Rotwild" werden diese Fragen beantwortet.
Erscheinungsbild

Langstreckenläufer
Die langen Beine, der lange Hals und die nahezu waagrechte Wirbelsäule machen das Rotwild zu einem guten und ausdauernden Läufer. Dies zeigt sich auch bei seinem Fluchtverhalten: In erster Linie versucht es nicht sich zu verstecken, sondern seine Verfolger über die Distanz abzuschütteln. Dafür flieht er bei Gefahr im Trab oder gestreckten Galopp über deutlich weitere Strecken als beispielsweise das Rehwild.
Das "Who`s who" beim Rotwild
Die Kälber sind die Jungtiere im ersten Lebensjahr. Sind sie männlich spricht man von Hirschkälbern, die weiblichen nennt man Wildkälber. Im zweiten Lebensjahr unterscheidet man die Schmalspießer (männlich) und Schmaltiere (weiblich). Ältere Hirsche werden entweder nach ihrer Geweihausbildung bezeichnet oder in die Alterskategorien junge, mittelalte oder alte Hirsche eingeteilt.
Ab dem dritten Lebensjahr bezeichnet man die weiblichen "Rothirsche" als Alttiere. Unter Kahlwild versteht man das weibliche Rotwild und die Kälber. Daher werden auch Kahlwild- und Hirschrudel unterschieden.
Wissenswertes auf einen Blick
- Wissenschaftlicher Name: Cervus elaphus
- Gewicht: Männliche Hirsche bis 250 kg; weibliche bis 170 kg
- Größe: Schulterhöhe 120 - 150 cm; Rumpflänge bis 250 cm
- Alter: bis zu 25 Jahre
- Geschlechterunterschied: Die männlichen Tiere sind größer als die weiblichen und tragen ein Geweih.
- Anzahl der Jungen: i.d.R. 1 Kalb
Der Hirsch "röhrt"

© Blesch H.
Hirsche "schrecken" manchmal so wie Rehe, nur viel lauter und dröhnender. Ein weibliches Tier "mahnt", wenn es Kontakt zu seinem Nachwuchs hält. Die wohl bekanntesten Laute aber geben die Hirsche von sich, wenn Ende September/Anfang Oktober Paarungszeit (Brunft) ist. Imposant und eindrucksvoll erscheint vor allem das "Röhren", das laute Rufen der Hirsche.
©Altmann, Dagmar / Tierstimmenarchiv Berlin
Rotwild in Bayern
Jagdstrecke
In den vergangenen 10 Jahren ist die Rotwildstrecke bayernweit angestiegen. Die Umweltbedingungen, gerade in den waldreichen Rotwildgebieten, haben sich in den vergangenen Jahren auf die Bestandsentwicklung positiv ausgewirkt, so dass zur Regulation vermehrt in die Rotwildbestände eingegriffen werden muss. Im Jagdjahr 2021/22 wurden in Bayern ca. 13.700 Stück Rotwild erlegt.
Streckendaten Rotwild in Bayern und nach Regierungsbezirken seit 1985 ![]() 246 KB
246 KB
Herkunft und Verbreitung
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© AndreaIzzotti-Fotolia.com
Als Ursprungsgebiet der Gattung Cervus gilt Zentralasien. Zahlreiche morphologische Anpassungen im Skelettbau sowie bei den Ernährungs- oder Sinnesorganen waren notwendig, um in den eher offenen Landschaften zu leben. Das Leben in Herden (Rudeln) und als hochbeiniger und schneller Läufer war vorteilhaft gegenüber Fressfeinden.
Ursprünglich kam Rotwild in ganz Europa mit Ausnahme von Nordskandinavien vor. Seine heutige Verbreitung erstreckt sich auf etwa 300 Vorkommen. Da das Rotwild empfindlich auf Störungen jeder Art reagiert, lebt es bei uns heute überwiegend in den größeren und geschlossenen Waldgebieten der Alpen und Mittelgebirge.
Lebensraum und Lebensweise
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© bergfee-Fotolia.com
Besonders als Waldbesitzer erhalten Sie hier detaillierte Informationen über Waldbesitz sowie über Wildschäden und Präventionsmaßnahmen.
Ernährung
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© theblacklion12-Fotolia.com
Rotwild im Jahresverlauf
Wann paart sich das Rotwild? Werden die Kälber bis ins nächste Jahr hinein gesäugt? Wie lange braucht ein Hirsch zur Entwicklung seines Geweihes? Nicht nur diese Fragen werden mit dem folgenden anschaulichen Diagramm beantwortet. Informieren Sie sich über die Aktivitäten des Rotwilds.

Die Brunft (Paarungszeit) ist im Herbst (September/Oktober). Nach der anschließenden Tragzeit, die ungefähr neun Monate dauert, bringen die Alttiere (Muttertiere) im Mai oder Juni in der Regel ein Kalb zur Welt, das meist bis ins nächste Jahr hinein gesäugt wird. Oftmals sogar bis in den März hinein.
Der Hirsch wirft im Februar und März sein altes Geweih ab, das bis zum Sommer neu gebildet wird. Die alte Monatsbezeichnung "Hornung" für den Februar hat hier ihren Ursprung.
Jägersprache
Für das Rotwild werden unter den Jägern folgende Begriffe verwendet:
- Spießer: Hirsch mit einem Geweih ohne Verzweigung, i.d.R. ein zweijähriger Hirsch (Schmalspießer)
- Grandeln: rudimentäre Eckzähne im Oberkiefer
- Wedel: Schwanz
- Eissprosse: Stangenende im Geweih zwischen der Aug- und Mittelsprosse, oft nur angedeutet oder auch ganz fehlend
- Brunftkugeln: Hoden (auch bei anderem Schalenwild)
- Passstangen: zusammenpassende Abwurfstangen von demselben Hirsch
- Kolbenhirsch: Hirsch während der Geweihbildung, Geweih im Bast
- Bast: fellartige Haut, die die Geweihstangen während des Wachstums umgibt (auch bei anderen Hirschartigen)
- Fegen: Abreiben des Bastes vom Geweih nach Abschluss des Geweihwachstums (auch bei anderen Hirschartigen)
- Petschaft: Abbruchstelle an der abgeworfenen Geweihstange
- Beihirsch: rangniederer Hirsch bei einem Brunftrudel
- Kahlwild: weibliches Rotwild und Kälber (haben keinen Kopfschmuck/Geweih)
Jagd und Management
Vernünftige Regulation durch Bejagung
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Deutsches Jagd- und Fischereimuseum
In unserer Kulturlandschaft steht dem Rotwild jede Menge Nahrung zur Verfügung. Die Populationsdichte würde sich ohne menschliches Eingreifen – trotz der oben beschriebenen Regulationsmechanismen – sehr stark erhöhen. Erhebliche Schäden auf Feldern und in den Wäldern mit negativen Auswirkungen auf unser Gemeinwohl wären die Folge.
Hohe Wilddichten erhöhen zudem das Risiko von Tierseuchen, die verheerende Auswirkungen auf Mensch und Tier haben können. Um Konflikte in der Kulturlandschaft und Leiden unter den Tieren zu vermeiden, ist daher die Bejagung die vernünftigste Form zur Regulation der Rotwildpopulation.
Jagdzeit des Rotwildes in Bayern ist vom 1. August bis zum 31. Januar (einjährige Tiere ab 01. Juni).

Rot-, Gams- und Rehwild sind die für den Bayerischen Alpenraum charakteristischen Schalenwildarten. Sie stehen in komplexen Wechselbeziehungen mit ihrem Lebensraum und spielen daher beim Erhalt der Multifunktionalität des Ökosystems Bergwald eine entscheidende Rolle.
Vor diesem Hintergrund hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten (BaySF) und unter Einbindung externer Experten ein Forschungskonzept ausgearbeitet.